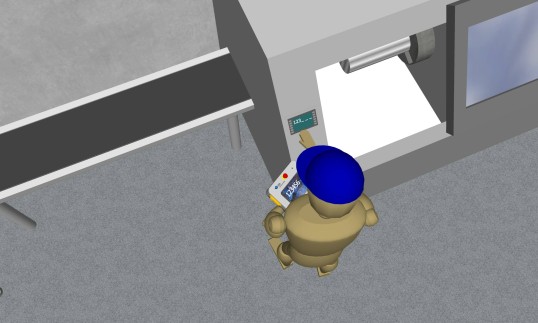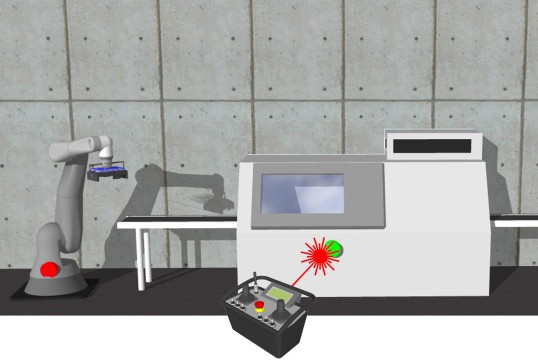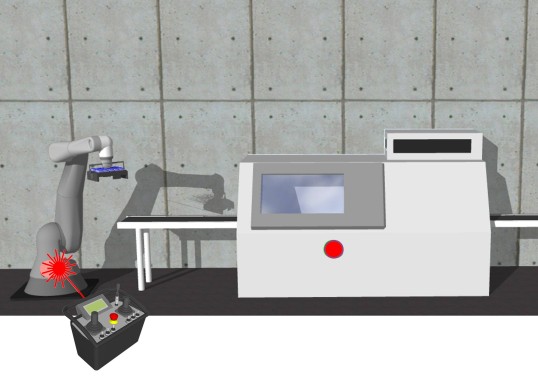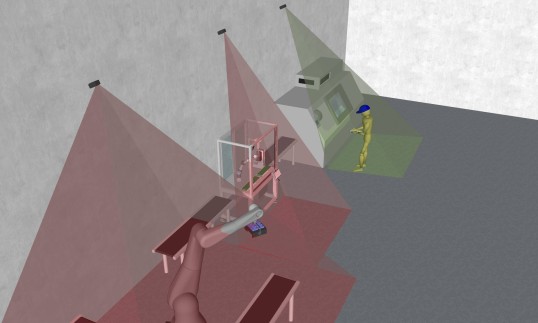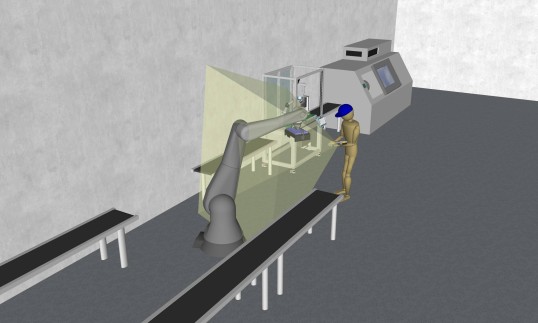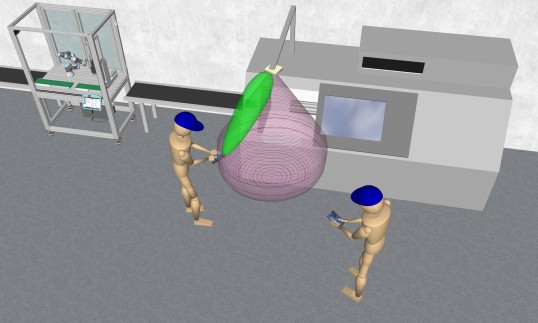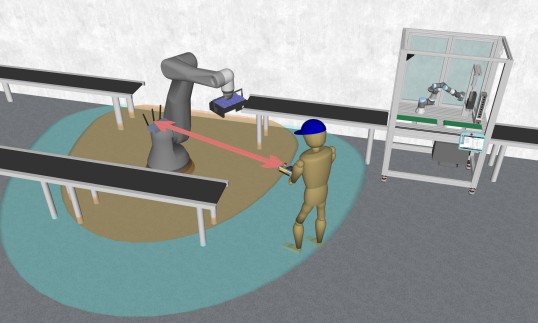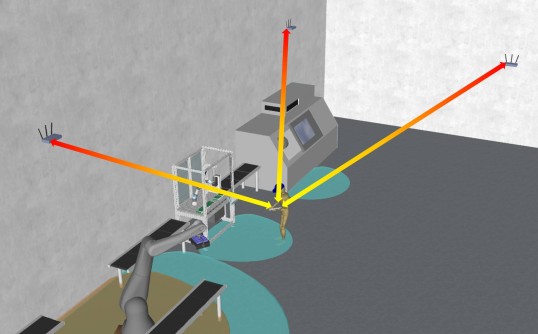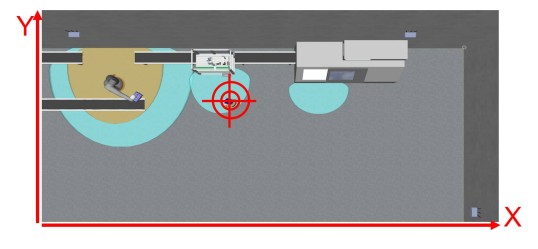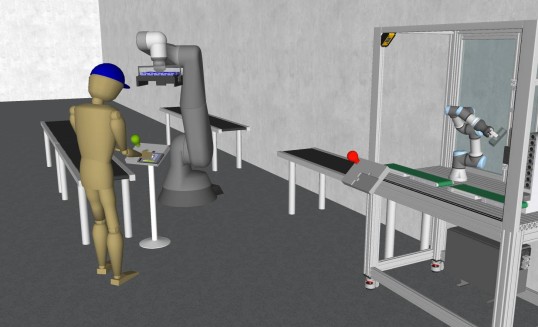- Elektromagnetische Felder
- Gefahrenschwerpunkt Frachtcontainer
- Innenraumarbeitsplätze
- Kühlschmierstoffe
- Praxishilfen: Ergonomie
- Praxishilfen: Gefahrstoffe
- Praxishilfen: Lärm
-
Praxishilfen: Maschinenschutz
- Absicherung von Tiergehegen
- Berührungslos wirkende Schutzeinrichtung
- Checkliste Maschinenergonomie
- EMV und Funktionale Sicherheit für Leistungsantriebssysteme
- Hilfen zu Hydraulik/Pneumatik
- Logikeinheiten für Sicherheitsfunktionen
- Manipulation von Schutzeinrichtungen
- Mobiles Bedienen
- Performance Level Calculator
- Prüfung der elektrischen Ausrüstung von Maschinen
- Risikobeurteilung von Arbeitsplätzen mit Cobots
- Schutzmaßnahmen an Karusselltüren
- Sichere Antriebssteuerungen mit Frequenzumrichtern (IFA Report 4/2018)
- Sichere Maschinensteuerungen nach DIN EN ISO 13849
- Software: SISTEMA
- Software: SOFTEMA
- Zinnwhisker auf Leiterplatten
- Praxishilfen: Persönliche Schutzausrüstungen
- Praxishilfen: Vibration
- Produktsicherheit
- Tätigkeiten mit krebserzeugenden Gefahrstoffen
- Nanomaterialien
Technische Umsetzungsbeispiele für eine Ortsbindung
Wie lässt sich nun die Bindung eines mobilen Steuergeräts an einen definierten örtlichen Bereich oder einen festen Standort als Voraussetzung für die Bedienfreigabe konkret technisch umsetzen? Nachfolgend sind beispielhafte Konzepte aufgeführt, mit denen sich eine solche Ortsbindung realisieren lässt.
Ansprechperson
Dipl.-Ing. Georg Nischalke-Fehn
Fax: +49 30 13001-38001
E-Mail
Unfallprävention: Digitalisierung - Technologien
Tel: +49 30 13001-3537Fax: +49 30 13001-38001